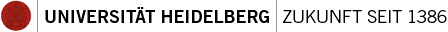Assur - Eine altorientalische Großstadt in Mesopotamien
Lokalisation und Forschungsgeschichte
 Die
antike Metropole Assur (modern Qal'at Scherqat), die über ein halbes
Jahrtausend lang die Hauptstadt des assyrischen Reiches und bis zu
dessen Untergangang Kultzentrum und Grablege der assyrischen Könige
war, liegt am westlichen Ufer des Tigris im Norden des heutigen Irak.
Die Siedlung erhebt sich auf einem gewaltigen, über 40m hohen
Kalksteinfelsen, der auf zwei Seiten durch den Tigris begrenzt wird und
als weithin sichtbare Landmarke in die Landschaft ragt.
Die
antike Metropole Assur (modern Qal'at Scherqat), die über ein halbes
Jahrtausend lang die Hauptstadt des assyrischen Reiches und bis zu
dessen Untergangang Kultzentrum und Grablege der assyrischen Könige
war, liegt am westlichen Ufer des Tigris im Norden des heutigen Irak.
Die Siedlung erhebt sich auf einem gewaltigen, über 40m hohen
Kalksteinfelsen, der auf zwei Seiten durch den Tigris begrenzt wird und
als weithin sichtbare Landmarke in die Landschaft ragt.
 Erste
"archäologische" Untersuchungen der Ruine fanden im 19. Jahrhundert
durch den englischen Diplomaten Austen Henry Layard und seinen
Mitarbeiter Hormuzd Rassam statt. Das Ergebnis dieser eher
oberflächlichen Sondagen waren eine Sitzstatue aus der Zeit des
assyrischen Königs Salmanassar III. (854-824 v. Chr.) sowie mehrere
Fragmente und Duplikate eines mit Keilschrift beschrifteten Tonprismas
Tiglat-Pilesars I. (1115-1077 v.Chr.), das eine relativ detaillierte
Beschreibung der Stadt und ihrer Bauwerke in mittelassyrischer Zeit
lieferte.
Erste
"archäologische" Untersuchungen der Ruine fanden im 19. Jahrhundert
durch den englischen Diplomaten Austen Henry Layard und seinen
Mitarbeiter Hormuzd Rassam statt. Das Ergebnis dieser eher
oberflächlichen Sondagen waren eine Sitzstatue aus der Zeit des
assyrischen Königs Salmanassar III. (854-824 v. Chr.) sowie mehrere
Fragmente und Duplikate eines mit Keilschrift beschrifteten Tonprismas
Tiglat-Pilesars I. (1115-1077 v.Chr.), das eine relativ detaillierte
Beschreibung der Stadt und ihrer Bauwerke in mittelassyrischer Zeit
lieferte.
 Die
ersten systematischen und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten
durchgeführten Grabungen begannen im Jahre 1903. Zunächst unter Leitung
des deutschen Architekten und Bauforschers R. Koldewey, der bereits
Babylon ausgegraben hatte, dann von seinem Schüler und Assistenten W.
Andrae. Durch eine speziell entwickelte Grabungstechnik ist es
seinerzeit gelungen, nahezu 25 Prozent der ca. 1,2 Quadratkilometer
großen Stadtfläche freizulegen, eine noch für heutige Verhältnisse
äußerst beachtliche Leistung. Nach elfjähriger, fast ununterbrochener
Grabungstätigkeit unter schwierigsten klimatischen und
organisatorischen Bedingungen, beendeten W. Andrae und sein
Mitarbeiterstab im Jahre 1914, unmittelbar vor Ausbruch des Ersten
Weltkrieges, die Ausgrabungen in Assur. Nach einer langen, durch die
Wirren des Krieges bedingten Odyssee erreichten die über 23.000
Fundstücke erst im Jahre 1926 die Berliner Museumsinsel, wo sie heute
im Vorderasiatischen Museum bewundert werden können.
Die
ersten systematischen und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten
durchgeführten Grabungen begannen im Jahre 1903. Zunächst unter Leitung
des deutschen Architekten und Bauforschers R. Koldewey, der bereits
Babylon ausgegraben hatte, dann von seinem Schüler und Assistenten W.
Andrae. Durch eine speziell entwickelte Grabungstechnik ist es
seinerzeit gelungen, nahezu 25 Prozent der ca. 1,2 Quadratkilometer
großen Stadtfläche freizulegen, eine noch für heutige Verhältnisse
äußerst beachtliche Leistung. Nach elfjähriger, fast ununterbrochener
Grabungstätigkeit unter schwierigsten klimatischen und
organisatorischen Bedingungen, beendeten W. Andrae und sein
Mitarbeiterstab im Jahre 1914, unmittelbar vor Ausbruch des Ersten
Weltkrieges, die Ausgrabungen in Assur. Nach einer langen, durch die
Wirren des Krieges bedingten Odyssee erreichten die über 23.000
Fundstücke erst im Jahre 1926 die Berliner Museumsinsel, wo sie heute
im Vorderasiatischen Museum bewundert werden können.
 Kleinere
Untersuchungen wurden in Assur 1988 und 1990 durch die Freie
Universität Berlin und die Universität München zwar wieder aufgenommen,
mussten aber durch den Golfkrieg und dessen Folgen abgebrochen werden.
Seither hat der irakische Antikendienst begrenzte Arbeiten
durchgeführt, über deren Verlauf und Ergebnisse jedoch kaum etwas
bekannt geworden ist. So bleibt für die archäologische und
philologische Forschung das von W. Andrae ermittelte Bild der Stadt bis
heute maßgebend und bestimmend.
Kleinere
Untersuchungen wurden in Assur 1988 und 1990 durch die Freie
Universität Berlin und die Universität München zwar wieder aufgenommen,
mussten aber durch den Golfkrieg und dessen Folgen abgebrochen werden.
Seither hat der irakische Antikendienst begrenzte Arbeiten
durchgeführt, über deren Verlauf und Ergebnisse jedoch kaum etwas
bekannt geworden ist. So bleibt für die archäologische und
philologische Forschung das von W. Andrae ermittelte Bild der Stadt bis
heute maßgebend und bestimmend.
Geschichte der Stadt
 Spätestens
seit der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. begann die koninuierliche
Besiedlung Assurs. Die ältesteten Tempelanlagen aus der sog.
frühdynastischen Zeit sind der Göttin Ischtar geweiht, die für die
Bereiche Liebe und Krieg zuständig war. Funde und Befunde vom Ende des
3. Jtsd.s v. Chr. und dem Beginn des 2. Jtsd.s v. Chr. sind in Assur
dagegen sehr spärlich, was jedoch auch den begrenzten Ausgrabungen in
den Schichten dieser Zeitstufen anzulasten ist. Allerdings beweisen die
zahlreichen Texte aus der assyrischen Handelskolonie Karum Kanesch
(modern Kültepe) in Anatolien (Türkei), dass Assur bereits in der
frühen altassyrischen Zeit das Zentrum eines weitverzweigten
Fernhandelsnetzes war. Im 18. Jahrhundert v. Chr. erlebte die Stadt
unter dem dynamischen Herrscher Schamschi-Addu I. (1815-1782 v. Chr.)
einen Höhepunkt, der sich archäologisch vor allem in einer regen
Bautätigkeit dokumentiert. So erhielt das Heiligtum des Stadt- und
Nationalgottes Assur und der zugehörige Stufenturm, die Ziqqurrat, in
dieser Zeit die bestimmende Grundrissstruktur. Monumentale Ausmaße
erreichte auch der sog. "Alte Palast" des Königs.
Spätestens
seit der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. begann die koninuierliche
Besiedlung Assurs. Die ältesteten Tempelanlagen aus der sog.
frühdynastischen Zeit sind der Göttin Ischtar geweiht, die für die
Bereiche Liebe und Krieg zuständig war. Funde und Befunde vom Ende des
3. Jtsd.s v. Chr. und dem Beginn des 2. Jtsd.s v. Chr. sind in Assur
dagegen sehr spärlich, was jedoch auch den begrenzten Ausgrabungen in
den Schichten dieser Zeitstufen anzulasten ist. Allerdings beweisen die
zahlreichen Texte aus der assyrischen Handelskolonie Karum Kanesch
(modern Kültepe) in Anatolien (Türkei), dass Assur bereits in der
frühen altassyrischen Zeit das Zentrum eines weitverzweigten
Fernhandelsnetzes war. Im 18. Jahrhundert v. Chr. erlebte die Stadt
unter dem dynamischen Herrscher Schamschi-Addu I. (1815-1782 v. Chr.)
einen Höhepunkt, der sich archäologisch vor allem in einer regen
Bautätigkeit dokumentiert. So erhielt das Heiligtum des Stadt- und
Nationalgottes Assur und der zugehörige Stufenturm, die Ziqqurrat, in
dieser Zeit die bestimmende Grundrissstruktur. Monumentale Ausmaße
erreichte auch der sog. "Alte Palast" des Königs.
 Nach
einer Phase des wirtschaftlichen, kulturellen und politischen
Niedergangs erlangte das assyrische Reich mit seiner Hauptstadt Assur
im 14. Jh. v. Chr. eine führende Rolle unter den altorientalischen
Staaten. König Assur-uballit (1365-1330 v. Chr.) und seine Nachfolger
konnten den Zusammenbruch des Mittani-Reiches und das dadurch
entstandene Machtvakuum in Nordmesopotamien nutzen und Assyrien in der
mittelassyrischen Zeit zur führenden Militärmacht aufbauen. Das
Stadtbild von Assur erhielt in dieser Zeit seine entscheidende Prägung
durch die zahlreichen Tempel, Paläste und Befestigungsanlagen; der
Bevölkerungszuwachs wird in der Erweiterung durch die sog. "Neustadt",
ein großflächiges Wohngebiet im Süden Assurs, evident. Tukulti-Ninurta
I. (1233-1197 v. Chr.), eine zentrale Herrschergestalt dieser Epoche,
ließ sich in einer sehr aufwendigen Baumaßnahme einen neuen Palast
errichten. Trotzdem verließ er Assur kurze Zeit später, vermutlich
aufgrund innenpolitischer Querelen, und gründete nur unweit entfernt
eine völlig neue Residenz, die er mit "Kar Tukulti-Ninurta" nach seinem
eigenen Namen benannte.
Nach
einer Phase des wirtschaftlichen, kulturellen und politischen
Niedergangs erlangte das assyrische Reich mit seiner Hauptstadt Assur
im 14. Jh. v. Chr. eine führende Rolle unter den altorientalischen
Staaten. König Assur-uballit (1365-1330 v. Chr.) und seine Nachfolger
konnten den Zusammenbruch des Mittani-Reiches und das dadurch
entstandene Machtvakuum in Nordmesopotamien nutzen und Assyrien in der
mittelassyrischen Zeit zur führenden Militärmacht aufbauen. Das
Stadtbild von Assur erhielt in dieser Zeit seine entscheidende Prägung
durch die zahlreichen Tempel, Paläste und Befestigungsanlagen; der
Bevölkerungszuwachs wird in der Erweiterung durch die sog. "Neustadt",
ein großflächiges Wohngebiet im Süden Assurs, evident. Tukulti-Ninurta
I. (1233-1197 v. Chr.), eine zentrale Herrschergestalt dieser Epoche,
ließ sich in einer sehr aufwendigen Baumaßnahme einen neuen Palast
errichten. Trotzdem verließ er Assur kurze Zeit später, vermutlich
aufgrund innenpolitischer Querelen, und gründete nur unweit entfernt
eine völlig neue Residenz, die er mit "Kar Tukulti-Ninurta" nach seinem
eigenen Namen benannte.
 In
der zweiten Hälfte des 10. Jh. v. Chr. begann mit dem Sieg über die
aramäischen Fürstentümer in Syrien und Nordmesopotamien sowie der
Erlangung eines direkten Zugangs zum Mittelmeer der Aufstieg Assyriens
zur Weltmacht. Nach einer kurzen Schwächeperiode konnten im 9. Jh. v.
Chr. die Könige Assurnasirpal II. (884-858 v. Chr.) und Salmanassar
III. (858-824 v. Chr.) das assyrische Reich wieder als führende Macht
in Vorderasien etablieren. Assur war fortan nicht mehr die Hauptstadt
des Reiches, blieb aber weiterhin das kultische Zentrum, bis es 614 v.
Chr. von einer Koalition aus Medern und Babyloniern völlig zerstört
wurde. Dies bildete gleichsam das Fanal für den endgültigen Untergang
des gesamten assyrischen Reiches nach 612 v. Chr.
In
der zweiten Hälfte des 10. Jh. v. Chr. begann mit dem Sieg über die
aramäischen Fürstentümer in Syrien und Nordmesopotamien sowie der
Erlangung eines direkten Zugangs zum Mittelmeer der Aufstieg Assyriens
zur Weltmacht. Nach einer kurzen Schwächeperiode konnten im 9. Jh. v.
Chr. die Könige Assurnasirpal II. (884-858 v. Chr.) und Salmanassar
III. (858-824 v. Chr.) das assyrische Reich wieder als führende Macht
in Vorderasien etablieren. Assur war fortan nicht mehr die Hauptstadt
des Reiches, blieb aber weiterhin das kultische Zentrum, bis es 614 v.
Chr. von einer Koalition aus Medern und Babyloniern völlig zerstört
wurde. Dies bildete gleichsam das Fanal für den endgültigen Untergang
des gesamten assyrischen Reiches nach 612 v. Chr.
 Vom
1. bis zum 3. Jh. n. Chr. ließen die Parther, die bedeutendsten
Kontrahenten des Römischen Imperiums in Mesopotamien, Assur erneut
aufleben, indem sie die Stadt noch einmal zu einem bedeutenden
Verwaltungs- und Kultzentrum ausbauten. Zahlreiche imposante Bauwerke
und Funde, darunter die typische grün glasierte Keramik, zeugen von
dieser letzten Blütezeit der altorientalischen Metropole.
Vom
1. bis zum 3. Jh. n. Chr. ließen die Parther, die bedeutendsten
Kontrahenten des Römischen Imperiums in Mesopotamien, Assur erneut
aufleben, indem sie die Stadt noch einmal zu einem bedeutenden
Verwaltungs- und Kultzentrum ausbauten. Zahlreiche imposante Bauwerke
und Funde, darunter die typische grün glasierte Keramik, zeugen von
dieser letzten Blütezeit der altorientalischen Metropole.
(Text: Jürgen Bär / Ulrike Lorenz)
Abbildungen:
links von oben nach unten:
Stadtplan von Assur (aus: W.
Andrae, Das wiedererstandene Assur, Leipzig 1938); Assur 2000:
Stadtansicht vom Fluss (Foto: J. Bär); Assur 2000: Stadtansicht nach
Westen mit Altem Palast im Vordergrund (Foto: J. Bär); Assur 2000: Die
Neustadt (Foto: J. Bär)
Luftbildaufnahme Assur (aus: B. Hrouda, Der Alte Orient, München 1991); Assur 2000: Die Ziqqurat (Foto: J. Bär); Assur 2000: Rekonstruktion des Tabira-Tores (Foto: J. Bär); Assur 2000: Der Tigris vom Ostufer der Stadt (Foto: J. Bär)