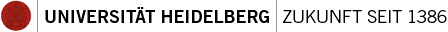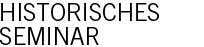Atelier Dezember 2024
Genie und Wahnsinn. Das Heidelberger Winteratelier begibt sich auf eine Reise ins Unbewusste
Ein Beitrag von Anna Scherer, 3. Fachsemester deutsch-französischer PhD-Track
Auch wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Winterateliers vom 12. bis zum 14. Dezember in der Stadt Heidelberg blieben, werden sie die Veranstaltung noch lange in Erinnerung behalten. Wir schauen auf drei spannende Tage zurück.
Zwischen Europa und Amerika, Alter und Neuer Welt
Die Präsentationen der Masterstudentinnen und Masterstudenten waren diesmal besonders zahlreich – einige unter ihnen kamen aus Amerika zurück, um nun ihr drittes und letztes Masterjahr abzuschließen. Konzentrationslager bildeten einen besonderen Schwerpunkt: Bianca Brendel (M2) stellte ihr Projekt über französische und tschechische politische Häftlinge in deutschen Konzentrationslagern vor und Chloé Lopez (M2) arbeitet zu intimen Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen Häftlingen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Auch die Neue Welt zog die Aufmerksamkeit der Studentinnen und Studenten auf sich: Lara-Marie Frick (M3) interessiert sich in ihrer Masterarbeit für deutsche Emigranten des 18. Jahrhunderts in Louisiana und Französisch-Guyana und Sigfrid Socher (M3) behandelt das kartographische Werk der Militäringenieure im Norden Spaniens im 18. Jahrhundert. Darüber hinaus sprach Janis Hofmann (M3) über sein Masterarbeitsprojekt mit dem Titel „Jugend und Geschlecht. Weibliche Adoleszenz im Poitou des Spätmittelalters“. Emanuel Marx (M3) forscht zu dem Schwarzbard-Prozess 1927, Joris Rastel (M2) interessiert sich für die industrielle Elite der antibolschewistischen Emigration in Frankreich und Deutschland und Felix Wiegandt (M2) hat sich dazu entschieden, über die Schlafkrankheit in Kamerun zu arbeiten. Daneben präsentierten die Doktoranden Jakob Fesenbeckh (D6) und Anna Scherer (D2) den aktuellen Stand ihrer Doktorarbeiten mit den Titeln „Die Arbeit regieren. Technokratie und autoritäre Erneuerung in Deutschland und Frankreich (1914–1945)“ und „Hunger nach Macht. Status, Position und Rolle des jüngeren Prinzen Xaver von Sachsen im Europa des 18. Jahrhunderts (1747–1793)“.
Eine Sammlung von Weltrang in Heidelberg
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer statteten der Sammlung Prinzhorn in der Heidelberger Weststadt einen Besuch ab. Das Museum stellt etwa 8000 historische Kunstwerke aus den Jahren 1840 bis 1945 von Menschen mit psychischen Erkrankungen aus – von Zeichnungen, Gemälden, Skulpturen bis zu Textilien und Texten aus der Feder von Else Blankenhorn, Franz Karl Bühle, Karl Genzel oder Agnes Richter, um nur ein paar zu nennen. Hinzu kommt ein neuer Bestand mit Werken, die seit den 1980er Jahren entstanden sind; hierzu zählen zum Beispiel die Arbeiten von Friedrich Boss, Gudrun Biersky oder Vanda Vieira-Schmidt. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen die Kunstwerke als Teil der sogenannten Art brut oder der Outsider Art. Der Kunsthistoriker und Psychiater Hans Prinzhorn (1886–1933) rief die Sammlung ins Leben. 1919 bis 1921 bat er verschiedene Psychiatrien um die Zusendung von Kunstwerken von Patienten. 1922 erscheint seine wissenschaftliche Abhandlung „Bildnerei der Geisteskranken“. Darin widmet er sich den sogenannten „zehn schizophrenen Meistern“, Künstlern, die sein Interesse besonders geweckt haben. Die Nationalsozialisten pathologisierten die Werke der Sammlung und nutzten sie für ihre Wanderausstellung „Entartete Kunst“ (1937–1941). Der Kurator Harald Szeemann (1933–2005) war es, der die Sammlung in den 1960er Jahren bei verschiedenen Ausstellungen wieder der Öffentlichkeit präsentierte. Seit 2001 befindet sich die Sammlung im alten Hörsaal der Neurologie des alten Universitätsklinikums in Heidelberg. Mit der Ausstellung der Werke der Menschen mit psychischen Erkrankungen hat sich das Museum zum Ziel gesetzt, zur Akzeptanz seelischer Leiden in der Gesellschaft beizutragen. Es möchte über die Geschichte der Sammlung, die Kontexte der Erkrankungen, über das Leben der Erkrankten und über die Bedeutung der Kunstwerke mit Dauerausstellungen und Sonderausstellungen informieren.
Begeistert gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Gänge der Dauerausstellung und auch der Sonderausstellung „Anima-L.“, die sich mit Kunstwerken in Zusammenhang mit Tierabbildungen von Menschen mit seelischen Leiden befasst. Die Museumsführerin erklärte den Besucherinnen und Besuchern das Leben der Urheber der Werke, wie die Objekte der Erkrankten zu deuten seien und die historischen Hintergründe, die es zu berücksichtigen gilt. Die Behandlung der Patientinnen und Patienten erfolgte Anfang des 20. Jahrhunderts noch ohne Medikamente. In Zeiten des Krieges und des Materialmangels bedienten sich die Patientinnen und Patienten einfachen Materialien wie Klopapier und Bleistiften, ansonsten konnten sie auch auf andere Werkzeuge wie bunte Farben und Textilien zurückgreifen. Oft drückte man den Patientinnen und Patienten Materialien zum Malen in die Hand, um sie zu beschäftigen und ihnen Struktur im Alltag der Anstalten zu geben. Dies war mit einem erheblichen Kosten- und Materialaufwand verbunden, eine Menge an Papier, Paketen, Wachs und Stiften wurde gebraucht. Während männliche Patienten am Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem Maschinen und heroische Figuren malten, zeichneten Frauen ganz andere Motive wie Blumen; Patientinnen widmeten sich ebenfalls der Nähkunst und bestickten Textilien. Prinzhorn interessierte sich im Wesentlichen für die Bilder der Männer und nicht für die Werke der Frauen. Die Museumsführerin zeigte zum Beispiel die Werke von Karl Genzel (1871–1925), dessen Diagnose „Dementia praecox“ (vorzeitige Verblödung, Schizophrenie) lautete; er schuf Skulpturen, zunächst aus gekautem Brot, dann aus Holz, die stark an Kunst indigener Stämme erinnerten. Emma Hauck (1878–1920) schrieb während ihres Aufenthaltes in der Klinik neben Bitten an ihre Familie, dass sie sie nach Hause holen sollte, auch Briefe, in denen sie Wörter wie „Schatzi“ und „Bartli“ wiederholte.
Lebhafte Diskussionen
Die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler diskutierten mit den Programmverantwortlichen und Fachkoordinatoren über die Forschungsprojekte: Welche Herangehensweisen eignen sich am besten für die Projekte? Welche Gliederungen passen? Welche Quellen sollten herangezogen werden? Welche Titel passen am besten? Wie können die Untersuchungen chronologisch und geographisch eingegrenzt werden? Welche Relevanz haben die Projekte für die Wissenschaft, die Gesellschaft und die Erinnerungskultur? Auf welche Probleme und Herausforderungen stoßen die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler noch? Auch die Sammlung Prinzhorn war Thema der Gespräche: Welches Verhältnis besteht zwischen Kunstwerken und psychischer Krankheit? Welche Methoden eignen sich, um die Kunstwerke der Erkrankten zu deuten? Welche Rolle kommt dem historischen Kontext für die Interpretation der Kunstwerke zu? Wie lassen sich die Kunstwerke beurteilen?
Danksagung
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Programmverantwortlichen, Fachkoordinatoren, Organisatoren und Mitwirkenden: Thomas Maissen, Florian Pfeiffer, Damian Domke, Emmanuel Saint-Fuscien, Julien Blanc und Jean-Hugo Ihl. Auch dem Museum der Sammlung Prinzhorn sei herzlich gedankt!
Das nächste Atelier des Master- und Doktorandenprogramms wird in Paris vom 2. bis zum 4. April 2025 stattfinden.