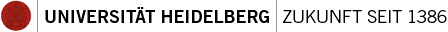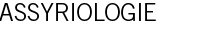Wer baute die babylonische Arche? Ein neues Fragment der mesopotamischen Sintfluterzählung aus Assur
Stefan M. Maul, Heidelberg
Nur wenige Jahre, nachdem die assyrisch-babylonische Keilschrift entziffert und die untergegangene semitische Sprache des Alten Mesopotamien soweit erforscht war, daß man akkadische Keilschrifttexte weitgehend verstand,
erregten die Ergebnisse assyriologischer Forschungen in einer breiten Öffentlichkeit
großes Aufsehen. Im Dezember 1872 stellte der britische Assyriologe
G. Smith auf einer Sitzung der Londoner Society of Biblical Archaeology
das Bruchstück einer Tontafel vor, das man in der assyrischen Hauptstadt
Ninive im Schutt des Palastes des Assyrerkönigs Assurbanipal gefunden
hatte. Das Tafelfragment, geschrieben im 7. vorchristlichen Jahrhundert,
gehörte zu einer Dichtung, in der in formvollendeter poetischer Sprache
die Geschichte von der Sintflut und dem "Überaus-Weisen" erzählt
wurde. Dieser hieß in der neu entdeckten keilschriftlichen Fassung nicht
Noah, sondern Utnapischtim, aber wie Noah war Utnapischtim der alles vernichtenden
Flut mit Hilfe einer
man akkadische Keilschrifttexte weitgehend verstand,
erregten die Ergebnisse assyriologischer Forschungen in einer breiten Öffentlichkeit
großes Aufsehen. Im Dezember 1872 stellte der britische Assyriologe
G. Smith auf einer Sitzung der Londoner Society of Biblical Archaeology
das Bruchstück einer Tontafel vor, das man in der assyrischen Hauptstadt
Ninive im Schutt des Palastes des Assyrerkönigs Assurbanipal gefunden
hatte. Das Tafelfragment, geschrieben im 7. vorchristlichen Jahrhundert,
gehörte zu einer Dichtung, in der in formvollendeter poetischer Sprache
die Geschichte von der Sintflut und dem "Überaus-Weisen" erzählt
wurde. Dieser hieß in der neu entdeckten keilschriftlichen Fassung nicht
Noah, sondern Utnapischtim, aber wie Noah war Utnapischtim der alles vernichtenden
Flut mit Hilfe einer
 nach genauen Vorgaben angefertigten Arche entkommen, in der, auf
göttlichen Rat, auch die Tiere das urzeitliche Weltengericht überlebt
hatten.
Die bis in Einzelheiten gehenden Parallelen zwischen dem neuen
"heidnischen"
Sintflut-Mythos und der wohlbekannten Noah-Erzählung des ersten Buches
der Thora (Gn 6-9), ließen keinen Zweifel daran, daß
die Verflechtungen des biblischen mit dem uralten mesopotamischen Gedankengut
weitaus enger waren, als man es je zuvor angenommen hatte. Daher entstand
sofort ein großes Interesse, den alten orientalischen Mythos zu rekonstruieren,
um ihn mit der biblischen Überlieferung vergleichen zu können.
nach genauen Vorgaben angefertigten Arche entkommen, in der, auf
göttlichen Rat, auch die Tiere das urzeitliche Weltengericht überlebt
hatten.
Die bis in Einzelheiten gehenden Parallelen zwischen dem neuen
"heidnischen"
Sintflut-Mythos und der wohlbekannten Noah-Erzählung des ersten Buches
der Thora (Gn 6-9), ließen keinen Zweifel daran, daß
die Verflechtungen des biblischen mit dem uralten mesopotamischen Gedankengut
weitaus enger waren, als man es je zuvor angenommen hatte. Daher entstand
sofort ein großes Interesse, den alten orientalischen Mythos zu rekonstruieren,
um ihn mit der biblischen Überlieferung vergleichen zu können.
Schon bald hatte man erkannt, daß die von Smith entdeckte keilschriftliche
Sintfluterzählung in ein großes Epos eingefügt war, das
die Abenteuer und Heldentaten des Königs Gilgamesch schildert. Obgleich
bis heute nicht unbeträchtliche Teile des auf zwölf Tafeln aufgeteilten
Gilgamesch-Epos unbekannt blieben, gelang es bereits sehr früh, aus
Tontafelbruchstücken unterschiedlicher Herkunft den Text der elften
Tafel des Epos mit der Sintfluterzählung nahezu lückenlos wiederherzustellen.
[1]
 Der "ferne Utnapischtim" berichtet in dieser Tafel dem Gilgamesch, der
rastlos nach dem Geheimnis des ewigen Lebens sucht, wie er als einziger
die Sintflut überlebt hatte und von den Göttern entrückt
und zu den Unsterblichen gezählt wurde. Lediglich der Wortlaut eines
kleinen Abschnittes der Tafel, der nur sechs Zeilen umfaßt (es handelt
sich um die Zeilen 49-54 der elften Tafel des Gilgamesch-Epos), konnte
bislang nicht rekonstruiert werden. Da jedoch in einem Textvertreter die
Zeilenenden dieses Abschnittes erhalten blieben, war klar, daß dort
vom Bau der Arche die Rede war.
Der "ferne Utnapischtim" berichtet in dieser Tafel dem Gilgamesch, der
rastlos nach dem Geheimnis des ewigen Lebens sucht, wie er als einziger
die Sintflut überlebt hatte und von den Göttern entrückt
und zu den Unsterblichen gezählt wurde. Lediglich der Wortlaut eines
kleinen Abschnittes der Tafel, der nur sechs Zeilen umfaßt (es handelt
sich um die Zeilen 49-54 der elften Tafel des Gilgamesch-Epos), konnte
bislang nicht rekonstruiert werden. Da jedoch in einem Textvertreter die
Zeilenenden dieses Abschnittes erhalten blieben, war klar, daß dort
vom Bau der Arche die Rede war.
Bei der Durchsicht der Tontafeln aus Assur im Auftrage der Deutschen Orient-Gesellschaft fand sich jetzt ein kleines, unpubliziertes Tafelfragment, das im Berliner Vorderasiatischen Museum unter der Signatur VAT 11000 aufbewahrt wird und eben die Zeilenanfänge enthält, die für die Wiederherstellung des einzigen noch unbekannten Abschnittes der elften Tafel des Gilgamesch-Epos vonnöten sind.
VAT 11000, die linke untere Ecke einer großen, ursprünglich dreikolumnigen
Tafel, wurde - wie die Zeichenformen nahelegen - wohl im 7. Jh. v. Chr.
geschrieben. Das einzige weitere bekannt gewordene Tontafelfragment aus
Assur, das der elften Tafel des Gilgamesch-Epos zuzuordnen ist, VAT 11087
[2],
gehört zu derselben, sehr sorgfältig gefertigten Tafel. Die beigegebene
Skizze
 zeigt, daß ein direkter Zusammenschluß der beiden Fragmente
jedoch nicht möglich ist. Der genaue Fundort beider Fragmente kann
leider nicht mehr ermittelt werden.
zeigt, daß ein direkter Zusammenschluß der beiden Fragmente
jedoch nicht möglich ist. Der genaue Fundort beider Fragmente kann
leider nicht mehr ermittelt werden.
VAT 11000 liefert uns, wie bereits an den spärlichen, zuvor bekannten Resten der Zeilen Gilg. XI, 49-54 ersichtlich war, eine lebhafte Schilderung vom Bau der Arche. Nicht in Heimlichkeit und ganz allein baute Utnapischtim das rettende Schiff, sondern in aller Öffentlichkeit und mit Hilfe des gesamten "Landes" [3], das doch kurz darauf von der Flut vernichtet werden sollte. Freiwillig arbeiteten nicht nur die Zimmerleute und die übrigen Facharbeiter, die auf einer Werft gebraucht werden, sieben Tage lang bis zur Fertigstellung des gewaltigen Schiffes, sondern auch groß und klein, arm und reich eilten zu Hilfe. Einer List des Weisheitsgottes Ea folgend, der Utnapischtim das Geheimnis der bevorstehenden Flut offenbart hatte, hatte der babylonische Noah seinen Mitmenschen die merkwürdige Absicht, Besitz und Reichtum zu lassen, um mit einem gewaltigen Schiff davonzufahren, damit erklärt, daß er den Unwillen Enlils, des Gottes, der in Wahrheit die vernichtende Flut befohlen hatte, auf sich gezogen habe. Nun müsse er sich zu den Wassern, dem Herrschaftsbereich seines Schutzgottes Ea, zurückziehen. Habe er aber erst die Stadt verlassen, so machte Utnapischtim die Menschen glauben, würde der Stadt großer Segen und Überfluß zuteil, den Enlil dann herabregnen ließe. Mit diesen täuschenden Versprechen des Utnapischtim setzt das neue Fragment der elften Tafel des Gilgamesch-Epos ein:
VAT 11000 [4]

| 45 | I | 1' | il?-[mesch-ra-a e-bu-ra-am-ma] |
| 46 | I | 2' | i-na sch[er ku-uk-ki] |
| 47 | I | 3' | i-na li-la-a-ti ú- |
| ________________________________________ | |||
| 48 | I | 4' | mim-mu-ú sch[e-e-ri i-na na-ma-a-ri] |
| 49 | I | 5' | ina bab(KÁ) A-tar-ha-[sis i-pah-hur ma-a-tum] |
| 50 | I | 6' | lúnagaru(NAGAR) na-schi [pa-as-su] |
| 51 | I | 7' | lúatkupu(AD.KID) na-schi [a-ba-an-schu] |
| 51a | I | 8' | a-ga-si-li-ga-[schu?(Stativ)] |
| 52 | I | 9' | schi-bu-ti i-[zab-bi-lu pi-til-ta]
[5] |
| 53 | I | 10' | lúetluti(GURUSCH.MESCH) i-gu[sch-schu(?)] |
| 54 | I | 11' | [sch]á-ru-u na-[schi kup-ra] |
| (Rand) | |||
| 55 | II | 1' | [lap-nu(...) hi-schih-tu ib-la] |
| etc. |
Übersetzung:
| 45 | Be[scheren? wird er (= Enlil) euch? Reichtum und auch (gute) Ernte]. |
| 46 | In der Morgenröte [wird er Kuchen], |
| 47 | in der Abenddämmerung [Schauer von Weizenkörnern auf euch herabregnen lassen]. |
| _______________________________________________________________ | |
| 48 | Kaum daß die Mor[genröte zu leuchten beginnt], |
| 49 | [versammelt das Land sich] im Tore des "Überaus-Weisen" (= Atar-hasis). |
| 50 | Der Zimmermann hält [sein Beil] bereit. |
| 51 | Der Rohrflechter hält [seinen Stein] bereit. |
| 51a | Seine Axt? [hält (o.ä) der? ...]. |
| 52 | Die alten Männer [bringen Strick herbei]. |
| 53 | Die jungen Männer ei[len herbei und?]. |
| 54 | Der Reiche hält [bereit das Pech]. |
| 55 | [Der Arme brachte, (...) was sonst noch vonnöten ist]. |
Kommentar:
| 45 | Die als il?-[ gedeuteten Spuren der ersten erhaltenen Zeile des Fragmentes VAT 11000 bilden wohl den Anfang einer Verbalform, die wahrscheinlich wie in Z. 47 mit dem Dativsuffix -kunuschi versehen war. Die wenigen Zeichenspuren reichen jedoch nicht aus, um das hier verwendete Verb zu ermitteln. Die in der Übersetzung vorgeschlagene Ergänzung mit dem Verb "bescheren" fußt somit lediglich auf inhaltlichen und nicht auf philologischen Überlegungen. |
| 49 | Atar-hasis, "Überaus-Weiser", ist hier ein Beiname des Utnapischtim. |
| 50 | Zu den Zeilen 50ff. vgl. M. Stol, AfO 35 (1988), S. 78. |
| 51a | Zu agasiliggu vgl. CAD A/I, S. 148f. (s.v. agasalakku) und AHw S. 16 [dort gedeutet als: "eine Art Band, Reif (z.B. um ein Beil)"] mit Belegen, die zeigen, daß ein agasiliggu ein Gerät oder Werkzeug ist, das aus Bronze gefertigt wurde. Gemeinsam mit Dolchen und Beilen wird es in Urkunden und lexikalischen Texten genannt. Es konnte ein Gewicht von etwa einem Kilogramm haben. Auf einer Tontafel aus dem Britischen Museum, auf der Leberomina verzeichnet sind, findet sich zudem die Skizze einer Lebermarkierung, die "wie ein agasiliggu" aussieht (siehe CT 39, Pl. 12, 9). Anhand der leider nur sehr groben Zeichnung ist es allerdings kaum möglich zu entscheiden, ob als agasiliggu tatsächlich, wie im CAD vorgeschlagen, eine Axt bzw. das Blatt einer Axt bezeichnet wurde. Für diese oder eine ähnliche Deutung spricht freilich der Text LKU n31, in dem ein agasiliggu neben anderen Götterwaffen genannt ist. |
| 53 | Die Lesung i-gu[sch-schu(?)] geht zurück auf einen Vorschlag von A. R. George. |
| 54 | In einer scharfsinnigen Notiz im AfO 35 (1988), S. 78 hatte M. Stol bereits vermutet, daß in der bisher bekannten Textfassung die Zeichenfolge SAR-ru(-)[ nicht für scherru, "(Klein)kind", sondern für scharû, "Reicher" steht. Diese Vermutung wird durch den hier vorgestellten neuen Textvertreter aus Assur bestätigt. |
| 55 | Die Parallelstelle in der altbabylonischen Fassung des Atrachasis-Epos (Tf. III, Kol. II, 14 [dort: la-ap-nu]) zeigt, daß hier nicht dan-nu gelesen werden kann. |
Wie die Skizze des in Assur gefundenen Textvertreters der elften Tafel des Gilgamesch-Epos zeigt, sind bisher nur etwa 5% der vermutlich in viele kleine Bruchstücke zerborstenen Tafel bekannt geworden. Es erscheint daher nicht unwahrscheinlich, daß sich in Zukunft unter den kleineren unpublizierten Tontafelfragmenten aus Assur, die im Vorderasiatischen Museum zu Berlin aufbewahrt werden, noch weitere Bruchstücke dieser Tafel finden lassen. Zwar sind viele der besser erhaltenen literarischen Keilschrifttexte aus Assur in den großen Keilschrifteditionen von E. Ebeling und F. Köcher [6] vorgelegt worden, aber dennoch lassen sich, wie das hier vorgestellte Stück VAT 11000 zeigt, unter den zahlreichen kleineren und stark beschädigten Tontafelfragmenten wichtige Funde machen. In den folgenden Jahren soll daher die Arbeit von E. Ebeling und F. Köcher fortgeführt werden.