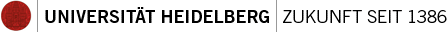Wittgenstein-Tag
--- Samstag, 20. Juni ---
Material:
Mit Vorträgen und Diskussionen zu:
14 Uhr:
Warum ethische Prinzipien grammatische Sätze sind, und was uns das
über das ethische Nachdenken sagt
von MATTHIAS KIESSELBACH (Potsdam)
Zwischen dem moralischen Partikularismus und dem moralischen Generalismus bleibt Raum für eine dritte, vermittelnde, Position. Sie erschließt sich, wenn wir ethische Prinzipien als grammatische Sätze (im Sinne Wittgensteins), und ethische Probleme als grammatische Spannungen interpretieren. In dieser Sicht erscheinen Situationen, in denen verschiedene ethische Prinzipien unerwartet konfligieren, als Stationen der sprachlichen Evolution. Drei Konsequenzen werden diskutiert und als generelle sprachphilosophische Erkenntnisse begrüßt.
MATTHIAS KIESSELBACH schreibt an einer Promotion über die Konsequenzen des Pragmatismus in der Moralphilosophie.
16 Uhr:
Grammatik und Empirie: Wie Wittgensteins Methode Erfahrung aufschließen kann
von Dr. WERNER KOGGE (Berlin)
Ich möchte zeigen, dass grammatische Betrachtung – das zentrale Verfahren der Wittgensteinschen Philosophie – durchaus geeignet ist, Erfahrung aufzuschließen. Dieser Auffassung scheint vieles entgegenzustehen, was Wittgenstein (und die Sekundärliteratur) über Autonomie der Grammatik und das Verhältnis von grammatischen und empirischen Sätzen schreibt. Ich werde demgegenüber versuchen, einige Unklarheiten in diesem Problemfeld zu beseitigen, indem ich Wittgensteins Überlegungen im Zusammenhang der Geschichte des Verhältnisses von Erfahrung und Begriff lese, wie es sich in der modernen Philosophiegeschichte entwickelt hat.
WERNER KOGGE schreibt an einer Habilitationsschrift über das semiotisch-semantische Vokabular in der Molekularbiologie und versucht Wittgensteins Methode für eine kritische Untersuchung fruchtbar zu machen.
18 Uhr:
Zur Grammatik der Natur
Was wir von Wittgenstein hinsichtlich des Verstehens der Natur lernen können
von MARC MÜLLER (Berlin)
Wittgenstein scheint ein recht abwegiger Kandidat zu sein, um von ihm über Natur und Naturphänomene zu lernen. Beschäftigt er sich doch mit Sprache und Logik. Die Art und Weise jedoch, wie er dort (in seiner Spätphilosophie) zu Erkenntnissen gelangt, kann uns trotzdem Vorbild sein: Wittgenstein fordert uns u. a. dazu auf, Beispiele für den Gebrauch der fraglichen Begriffe zu suchen, diese zu vermehren, zu variieren und abzuwandeln, nach Kriterien für Anwendungen zu fragen und die Verwandtschaftsverhältnisse von Sprachspielen auszuloten. Am Ende soll uns aufgrund tieferen Verständnisses das philosophische Problem verschwinden, ohne dass wir etwa „theoretisiert“ oder „erklärt“ hätten, sondern nachdem wir vielmehr „beschrieben“ haben.
Seit geraumer Zeit wird in verschiedenen physikdidaktischen Arbeitsgruppen an Wegen erscheinungsorientierten Unterrichts gearbeitet. Gemeinsames Ziel dieser Bemühungen ist es, ein weitreichendes Naturverständnis zu lehren, ohne die dabei vorgebrachten Erklärungen auf einem Fundament quasi ad hoc vorgeschlagener, hypothetischer Entitäten wie z. B. Strahlen oder Wellenfelder errichten zu müssen.
Ich meine zum einen, dass das physikalische Projekt von dem philosophischen in methodischer Hinsicht lernen kann und zum anderen, dass Wittgensteins Methode selbst gewinnt, wenn sie auch dort anwendbar wird, wo die kontingenten Sprachspiele auf den Widerstand der Realität treffen.
MARC MÜLLER hat Philosophie und Physik in Leipzig und Berlin studiert und promoviert derzeit am Institut für Didaktik der Physik der Humboldt-Universität zu Berlin zur Methode erscheinungsorientierter Physik.
Alle Vorträge finden c.t. im Hegelsaal des Philosophischen Seminars, Schulgasse 6, statt.
Organisation/Kontakt: Friederike Schmitz in Zusammenarbeit mit dem delta-Verein.