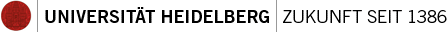Promotionsprojekte
- Christina Lucas, Poetologie des Gedankengangs. Der Flaneur unterwegs in antiken Textwelten (Arbeitstitel)
Der Gedankengang wird nicht erst seit dem gegenwärtigen Achtsamkeitstrend durch die Generationen X, Y und Z im virtuellen spiritual place gehypter Meditationsapps wie Headspace verfolgt: Die Interdependenz von Gehen und Denken beherrscht seit jeher den diskursiven Raum philosophisch-literarischer Textwelten und fügt sich desgleichen in die soziologische Theoriebildung ein. Der Flaneur, der sich abseits der Moderne natürlicherweise in anthropologisch anderer Formung und Denotation zeigt, soll im hier angestrebten Versuch einer Archäologie der flânerie bestimmend sein.
Als besonders eindrückliches Beispiel für die aktuelle Relevanz des Forschungsprojektes mag das Pandemiegeschehen während der Jahre 2020 bis 2023 gelten. Dieses kann und konnte in seiner Brisanz sowohl kreativer Provokationspunkt sein, als auch aufgrund des dadurch bedingten Mangels an Kontakt und Austausch geistige Konfrontation als denkanstoßendes Hindernis unterbinden: Wie ist und war dieser Situation der Enge und des Beschränkt-Seins oftmals besser zu entkommen als durch das Hinausgehen ins Freie, wenngleich mit dem erforderlichen Abstand zum Gegenüber? Der Spaziergang in all seinen Facetten boomt, er erlebt eine Renaissance. Vor diesem Hintergrund ist die im Gedankengang angelegte Möglichkeit zur Erkundung des existentiell intellektuellen Bedürfnisses des Gehens und Denkens nicht nur in einer möglichen Retrospektive aktueller denn je zuvor. Zugleich stellt dies ein Desiderat in der Forschung dar, konzentrieren sich die (literatur-)wissenschaftlichen Studien doch bisher auf die westlichen Literaturen der Moderne und in Teilen auf diejenigen der Gegenwart.
Ziel dieses Dissertationsvorhabens ist es, mittels eines Textkonvoluts aus der lateinischen Literatur durch die komparatistische Kontrastfolie europäischer moderner Literaturen zu untersuchen, inwiefern der Flaneur einen literarischen Typus darstellt, der in seinem spezifischen Modus des Gehens und Denkens bereits in antiken Texten präfiguriert ist. Das Postulat des Flanierens als intellektueller Gestus erweckt die zentrale Forschungsfrage, inwiefern ein Archetypus des Flaneurs als poetologisches Konstituens an der Textoberfläche antiker Literatur manifest wird oder als bloße Motivik des Gehens angelegt ist. Die Untersuchung der jeweiligen Aspekte kann in einer Poetologie des Gedankengangs münden.
Betreuung: Jürgen Paul Schwindt / Joséphine Jacquier
- Isabel Mand, Zerstückelte Körper und entstellte Gesichter – Ästhetisierte Gewalt in lateinischer und französischer Kriegsliteratur und ihr Potenzial für die ästhetisch-literarische Bildung (Arbeitstitel)
Das Ziel meines Promotionsvorhabens ist es, Beschreibungen versehrter Körper in lateinischer und französischer (Bürger-)Kriegsliteratur zu untersuchen, die ihnen eigene Ästhetik offenzulegen und davon ausgehend das Potenzial dieser Texte für den schulischen Literaturunterricht auszuloten. Als Grundlage möchte ich zwei Texte aus Antike und Moderne heranziehen: LUCANS unvollendetes Bürgerkriegsepos De bello civili und ANDRÉAS BECKERS 2015 erschienene Erzählung Gueules, welche die im Gesicht verletzten und entstellten Soldaten der Grande Guerre, die sog. gueules cassées, thematisiert.
Die vergleichende Lektüre von Lucan und Becker soll zu den folgenden Themenkomplexen erfolgen: (1) die Darstellung des zerstückelten Körpers / des entstellten Gesichts, (2) die Gestaltung des Sterbeprozesses, des Zustands zwischen Leben und Tod und der Unsterblichkeit durch Monumentalisierung (3) die Inszenierung des entstellten Körpers und deren textimmanente Rezeption, (4) Gewalt und Erkennen bzw. (Nicht-)Erkannt-Werden, (5) Individuum und Kollektiv sowie (6) die Überführung der körperlichen Entstellung in die Gestalt des Textkörpers. Ich möchte im Rahmen dieser philologischen Analyse aufzeigen, welche Ästhetisierungsverfahren in literarischen Texten zur Anwendung kommen, wenn Gewalthandlungen im Zusammenhang von Krieg zum Thema werden.
In einem zweiten Schritt soll ausgehend von der philologischen Analyse diskutiert werden, welches Potenzial die Beschäftigung mit LUCAN und BECKER für die ästhetisch-literarische Bildung haben kann. Dabei werden drei Schwerpunkte gewählt: (1) die Kultivierung von ästhetischen Erfahrungen im Schulunterricht durch die Schulung eines ästhetischen Wahrnehmungsmodus, (2) die Irritation der Rezipient*innen bei der Lektüre literarischer Texte als Katalysator für literarästhetische Erfahrungen und (3) das Potenzial von Kriegstexten für empathische und ethische Erkenntnisse im Zusammenhang mit Alteritätserfahrung, Perspektivübernahme und der grundlegenden Auseinandersetzung mit den ‚guten und bösen Seiten‘ des Menschen an sich. Am Anfang dieser theoretischen Überlegungen sollen immer die Erkenntnisse der close readings stehen, sodass eine enge Rückkopplung der literaturdidaktischen Theorien an die literarischen Texte gewährleistet ist.
Betreuung: Joséphine Jacquier/Herle-Christin Jessen
- Ilaria Pinzo, Ovid-Calvino: Sechs Interpretationsvorschläge für die Metamorphosen
Italo Calvino, ein Schriftsteller von großer literarischer Sensibilität, entwickelt in seinen Sechs Vorschlägen für das nächste Jahrtausend (1988) eine Vorstellung von Literatur, die auf sechs grundlegenden Eigenschaften besteht, welche jedem großen Werk gemein sind: Leichtigkeit, Geschwindigkeit, Genauigkeit, Sichtbarkeit, Vielfältigkeit und Konsistenz (unvollendet).
Calvino folgt den Spuren einiger der einflussreichsten Autoren der Antike und der Moderne, um diese sechs Qualitäten der Literatur zu thematisieren, die, so sein Wunsch, auch in die literarischen Werke der Zukunft hineinwirken sollen.
Unter den in diesem Werk vertretenen Autoren gibt es einen, den der italienische Schriftsteller besonders schätzt und in dessen Meisterwerk all die in den Sechs Vorschlägen theorisierten Merkmale der Literatur vorhanden sind: Dieser Autor aus der Vergangenheit, der mit zukünftigen Perspektiven beladen wird, ist Ovid.
Basierend auf diesen Qualitäten der Literatur bietet Calvino brillante interpretative Einblicke in die ovidischen Metamorphosen an: das Ziel meines Promotionsprojekts ist es, diese Gedankenkeime zu fundierter literaturkritischer Forschung weiterzuentwickeln.
Obwohl der italienische Autor nur das Vorhandensein einiger dieser Grundmerkmale in Ovids Werk konstatiert, ermöglicht seine Vision nichtsdestoweniger eine neue Perspektive, aus der man die Metamorphosen auf unerwartete, überraschende Weise betrachten kann, beispielsweise indem man einen Einblick in die auf die Literatur angewandte (Natur-)Wissenschaft wagt, wie Calvino vorzuschlagen scheint.
Calvinos Werk soll mir als Kompass dienen, um mich in dem besser zu orientieren, was in Ovids Werk noch unerforscht ist, und mir dabei helfen, innovative Interpretationsschlüssel zu finden, um ein neues Verständnis des ovidischen Gedichts zu erlangen.
Betreuung: Jürgen Paul Schwindt